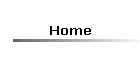Kurzer
Überblick
Künstlicher Schnee besteht aus feinen Eispartikeln.
Gravierende Unterschiede zu natürlichem Schnee bestehen
in Konsistenz, Form und Verhalten.
Während der natürliche Schnee als Eiskristall langsam wächst und die
bekannten und beliebten, teils großformatigen Schneeflockenform aufweist, wird
Kunstschnee erzeugt indem Wasser in kalter Luft zerstäubt wird. So entstehen
kleine geformte Eiskristalle, die sich durch die geringe Fallhöhe schnell
wieder am Boden niederschlagen und eine Puder- bis reifartige Konsistenz
besitzen. Die Beschaffenheit des Kunstschnees macht ihn schwerer und
dichter als natürlichen Schnee, er ist resistenter gegen Tauwetter und Regen
und bildet relativ rasch eine sehr harte Schicht (Harsch), die neues Beschneien
erfordert, um die Pisten befahrbar zu halten.

WAS
IST KUNSTSCHNEE?
Zum Produzieren von Kunstschnee benötigt man Wasser,
Luft und Energie. Die Schneekanonen versprühen das Wasser durch Düsen
mit einer großen Luftmenge in feinste Tröpfchen. Ein Teil des Wassers
verdunstet und entzieht der Umgebungsluft die Wärme. So unterkühlt der größte
Teil der Tröpfchen und gefriert. Kleine Eiskristalle und gefrorene Wasserkügelchen
fallen als Kunstschnee zu Boden.
Erst bei Lufttemperatur unter –3°C, weniger als
80% Luftfeuchtigkeit, und einer Wassertemperatur von 2°C soll
Kunstschnee erzeugt werden.
WOMIT
WIRD KUNSTSCHNEE ERZEUGT ?
Energie
Der bisherige Energieeinsatz beträgt 0,2 bis etwa
0,8kWh pro Quadratmeter Beschneiungsfläche. Beim Energieverbrauch bestehen große
Unterschiede je nach Standort, System, Wasserbeschaffung und Klimabedingungen.
Große Anlagen mit mehreren Schneekanonen verbrauchen über 500 000 kWh pro
Saison. Zum Vergleich: ein 4-Personenhaushalt verbraucht zwischen 3000 und 7000
kWh jährlich.
Der heutige Trend ganze Pisten zu beschneien erhöht
den Energieverbrauch drastisch. Für die Tiroler Wasserkraftwerke TIWAG zählen
Schneekanonen- zu den ungünstigsten Stromverbrauchern, da sie meist nur in den
am stärksten belasteten Wintermonaten in Betrieb sind. „ Außerdem wird
hochwertiges und zur Stromerzeugung dringend gebrauchtes Trinkwasser wieder in
Schnee zurückverwandelt, um dann letzten Endes zu einer Zeit, in der das
Wasserangebot ohnehin hoch genug ist, wieder als Schmelzwasser zur Verfügung
stehen.“ (Umweltbundesamt Österreich)

Wasser
Pro Saison rechnet man mit
einem Wasserverbrauch von 200 bis 600l pro Quadratmeter Beschneiungsfläche. Das
Wasser wird Bächen, Flüssen, Quellen oder der Trinkwasserversorgung –
ausgerechnet in extrem wasserarmen Zeiten, bei Frost – entzogen. Bei einer
Idealtemperatur von unter –11°C ist die Wasserentnahme am höchsten, da die
Kanonen mit Vollgas beschneien können. Bei so starkem Frost ist in der Natur
alles freie Wasser gebunden, Bäche und Quellen haben ihr Niedrigstwasser.
Wenn die
Wassertemperaturen des Grund- und Quellwassers zu hoch sind, werden Kühltürme
gebaut. Der Bau von Staubecken soll die Wasserversorgung der
Beschneiungsanlagen sichern.

Kunstschneeerzeugung
beeinflusst die Umwelt
in vielfältiger und überwiegen unerforschter Art und Weise :
v
Der
hohe Wasserverbrauch stört das ökologische Gleichgewicht der Vorfluter
(Quellen, Flüsse, Bäche) , die im Winter ohnehin nur wenig Wasser führen.
v
Die
Lawinen- und Erdabrutschgefahr wird durch den erhöhten Schmelzwasseranfall
verstärkt.
v
Das
Ausapern beschneiter Flächen verzögert sich gegenüber dem natürlichen
Abtauen um durchschnittlich 2 Wochen. Diese Verkürzung der Vegetationsperiode
erschwert die Entwicklung gerade spätblühender Arten, die Artenvielfalt kann
zurückgehen.
v
Das
verwendete nährstoffreichere Wasser kann zu einer Verschiebung des
Pflanzen-Artenspektrums führen.
v
Die
Dichte der Schneedecke und verlängerte Schneebedeckung im Frühjahr
vermindern die Sauerstoffversorgung im Boden, was Fäulnis und Schimmelbildung
zur Folge haben kann.

v
Die
Lärmbelastung durch
(meist nachts) laufende
Beschneiungsanlagen kann bei entsprechender Schallwirkung gerade in engen Tälern
enorm sein. Trotz einzuhaltender Grenzwerte können für Anwohner und Urlaubsgäste
in der Nähe einer Anlage erhebliche Ruhestörungen auftreten. Auch die Tiere fühlen
sich durch die so und so kritische
Winterzeit und den Lärm gestört und, kann sich auch bei ihnen belastend
auswirken.
v
Kunstschnee
führt zu einer Attraktivitätssteigerung eines Schigebietes, da auch in
den klimatisch ungünstigen Phasen Schneegarantie vorhanden ist, was zu bedeuten
hat, dass eine weitere Zunahme der Touristenzahl zu befürchten ist.
v
Ein
Vorteil des künstlichen Schnee ist, dass Boden und Vegetation durch die
geschlossene Schneedecke vor mechanischen Schäden (Pistenraupen usw.), aber
auch vor Frostschäden geschützt werden.


Quellen:
www.skiresort.de/deutsch/kunstschnee.htm
www.slf.ch/lebensraum-alpen/kunstschnee-umwelt-de.html
www.wsl.ch/info/jb00/Kunstschnee.PDF
www.allgaeutouren.de/ain/spirale/snow.htm
home.t-online.de/home/ivg.fsb/page7.htm
Alpine Vegetation (Diplomarbeit)